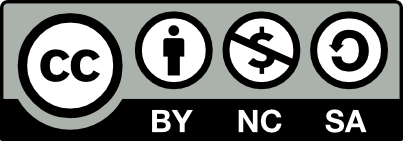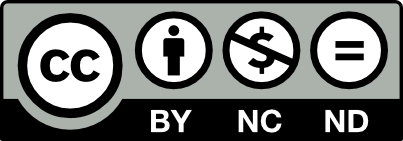Content begins here
Main page content
Click to collapse
Grundlagen beherrschen
Click to collapse
Selbst in einer zunehmend digitalen Welt bilden die Grundlagen digitaler Kompetenzen das Fundament für erfolgreiches Navigieren im Online-Zeitalter. Dieses Kapitel erkundet die essenziellen Fertigkeiten und Kenntnisse in Bezug auf rechtliche Fragen rund um Datenschutz und Sicherheit sowie digitaler Zusammenarbeit. So kannst du grundlegende Kompetenzen entwickeln, um effektiv digitale Technologien zu nutzen.
Digitale Kommunikation & Zusammenarbeit Click to collapse
Digitale Kommunikation und Zusammenarbeit
Die Interaktion und Kommunikation sowohl unter Studierenden als auch mit Lehrenden stellen entscheidende Bestandteile des Arbeitslebens aber auch des Studiums dar. Dieser Austausch ermöglicht gemeinsames Lernen durch den Austausch von Berufs- und Lebenserfahrungen. In Online-Kursen wird die Bedeutung der Kommunikation noch deutlicher. Aufgrund der fehlenden persönlichen Interaktion zwischen den Lernenden, kann schnell ein Gefühl der Isolation entstehen. Um dem entgegenzuwirken und trotz räumlicher (und zeitlicher) Distanz die Vernetzung und Zusammenarbeit zwischen den Lernenden und Lehrenden zu fördern, sollten bestimmte Regeln befolgt werden.
 Kommunikation im virtuellen Raum
Kommunikation im virtuellen Raum
Es werden zwei grundlegende Arten der Kommunikation unterschieden: asynchrone (zeitversetzte) und synchrone (zeitgleiche) Interaktion. Die wesentlichen Charakteristika dieser beiden Formen sind im Folgenden erläutert.
| Charakteristiken | Tools am MCI | |
|---|---|---|
| Asynchrone Kommunikation |
Asynchrone Kommunikation zeichnet sich dadurch aus, dass sie nicht gleichzeitig stattfindet. Das bedeutet, dass |
Sakai Diskussionsforen |
| Synchrone Kommunikation |
Synchrone Kommunikation ist gekennzeichnet, dass alle Lernenden zur selben Zeit im selben (virtuellen) |
Study (Big Blue Button) |
Die Online-Kommunikation weist eine Reihe von Merkmalen auf, die sich darauf auswirken, wie wir interagieren. Dazu gehören:
|
Das Fehlen von nonverbalen Signalen Kommunikation ist geprägt von nonverbalen Signalen wie Körpersprache, Mimik und Gestik, da sie Worte in einen Kontext setzen und uns helfen, die Intention hinter einer Nachricht zu verstehen. Dabei sind para-verbale Signale wie Stimmfarbe und Tonlage ebenfalls entscheidend. Bei Online-Kommunikation fehlen diese wichtigen nonverbalen Hinweise, weshalb wir oft auf Emoticons oder Abkürzungen zurückgreifen, um sie teilweise zu kompensieren. Dies kann jedoch die zwischenmenschliche Dynamik beeinträchtigen, da die Distanz in virtuellen Gesprächen größer ist als in persönlichen Gesprächen. |
"Social Presence“ "Soziale Präsenz" bezieht sich auf das Gefühl der persönlichen Verbundenheit und Interaktion in der Kommunikation. In Arbeits- und Lernumgebungen kann ein starkes Gefühl der Zugehörigkeit die Zusammenarbeit und Motivation positiv beeinflussen. Um auch in Online-Settings eine hohe "soziale Präsenz" zu erreichen, sind eine aktive Teilnahme und Beiträge zu Aktivitäten wichtig, um anderen das Gefühl zu vermitteln, dass man präsent und engagiert ist. |
Der Umgang mit unangemessenem Verhalten Studien haben gezeigt, dass einige Menschen sich in Online-Interaktionen weniger höflich und angemessen verhalten. Dies ist vermutlich auf die Annahme der Anonymität zurückzuführen. Solches Verhalten kann zu Aggressionen und negativen Erscheinungen wie Mobbing, Stalking, Rassismus und Sexismus führen. Meist ist diese Anonymität nicht gegeben. Unangemessenes Verhalten sollte genauso wie in persönlichen Interaktionen nicht toleriert werden und nötige Konsequenzen eingeleitet werden. |
 Netiquette
Netiquette
Besonders wichtig ist die Festlegung von Regeln für die Online-Kommunikation, auch bekannt als Netiquette. Diese Regeln fungieren sozusagen als Leitfaden für eine verantwortungsvolle und effiziente Interaktion im virtuellen Raum. Sie helfen dabei, Standards für den Umgang miteinander zu setzen und eine gemeinsame Lernkultur in der Online-Community zu etablieren.
Die akutelle Netiquette des MCI findest du hier!
-
 Zusammenarbeit in virtuellen Teams
Zusammenarbeit in virtuellen Teams
In deinem Studium wirst du nicht nur in den Präsenzphasen zusammenarbeiten, sondern auch in den online Phasen Gruppenarbeiten zu erledigen haben. Damit wirst du in einem sogenannten „virtuellen Team“ arbeiten. In diesem Abschnitt werden wir uns mit den Besonderheiten der online Gruppenarbeit beschäftigen, dabei kurz die Charakteristiken und Erfolgsfaktoren von virtuellen Teams beleuchten, und uns dann überlegen, wie Technologien zur effektiven Zusammenarbeit in diesem Kontext eingesetzt werden können.
Charakteristiken von virtuellen Teams:
Virtuelle Teams, ob im Studium oder im Beruf, zeichnen sich durch folgende Merkmale aus:
-
Sie sind eine Gruppe von Individuen, die an einem gemeinsamen Ziel arbeiten
-
Sie sind typischerweise geographisch disloziert
-
Sie verwenden Informations- und Kommunikationstechnologien um die Zusammenarbeit zu ermöglichen
-
Sie sind alle verantwortlich für das Erreichen des gemeinsamen Zieles
-
Die Dauer der Zusammenarbeit von virtuellen Teams ist oft begrenzt.
Erfolgsfaktoren:
Der Erfolg von virtuellen Teams hängt unter anderem davon ab,
-
ob es klare (im Idealfall schriftliche) Richtlinien zur Arbeit des Teams gibt
-
inwieweit das gemeinsame Ziel und der Weg dorthin von allen (gleich) verstanden wird und auch dokumentiert ist
-
wie gut es dem Team gelingt, sich im online Raum zu vernetzen, zu kommunizieren, und alle notwendigen Informationen und Erkenntnisse auszutauschen
-
wie effizient die Teammitglieder die verfügbaren Technologien zur gemeinsamen Arbeit verwenden
-
inwieweit es im Team eine gute Arbeitskultur und eine Vertrauensbasis gibt. Diese kann eine besonders große Herausforderung für virtuelle Teams sein.
 Technologien für (virtuelle) Zusammenarbeit
Technologien für (virtuelle) Zusammenarbeit
Für virtuelle Teams gelten natürlich die gleichen Erfolgsfaktoren wie für alle anderen Teams. Gerade für die Arbeit von Teammitgliedern, welche räumlich getrennt sind, werden Technologien für die Zusammenarbeit benötigt: Im Folgenden findest du eine Zusammenfassung gängiger Programme für die (virtuelle) Teamarbeit:
|
Kommunikation |
|
|
Dateienfreigabe |
|
|
Kollaborative Dokumentenbearbeitung |
|
|
Produktivität |
Datenschutz & Sicherheit Click to collapse
Datenschutz & Sicherheit
Das Recht auf Datenschutz ist ein Grundrecht und bezieht sich einerseits auf den Schutz der eigenen persönlichen Daten. Darunter werden personenbezogene Daten, wie zum Beispiel Name, Geburtsdatum oder Adresse verstanden, die es ermöglichen dich als Person genau zu identifizieren. Sehr sensible Daten sind hierbei auch gesundheitliche Informationen oder Informationen über politische Meinungen, die als besonders schützenswert gelten.
Der Datenschutz ist einerseits in der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und das Datenschutzgesetz (DSG) rechtlich geregelt. Konkret bedeutet dies, dass personenbezogene Daten nur mit Zustimmung der betroffenen Person verarbeitet und gespeichert werden dürfen. Somit hat auch jedes Individuum das Recht darauf zu erfahren, welche persönlichen Daten von Dritten verarbeitet werden.
Da gerade im Internet viele Daten auch unbewusst gespeichert werden, ist es wichtig, die eigenen persönlichen Daten zu schützen bzw. sich mit der eigenen „Internet-Identität“ regelmäßig auseinanderzusetzen. Dadurch können Angriffe auf die Privatsphäre, welche zu negativen Auswirkungen führen können, vermieden werden. Grundsätzlich betrifft Datenschutz im Internet besonders:
-
Generierung sicherer Passwörter
-
Schutz des eigenen Computers/Laptops
-
Umgang mit Sozialen Medien
-
Nutzung öffentlicher Computer
-
Urheberrechte an Schriftstücken und Bildern
Tipps und Tricks zum Schutz der persönlichen Daten im Internet bietet Saferinternet.at. Dort könnt ihr eine Liste mit Handlungsanweisungen zum Schutz eurer persönlichen Daten im Internet und weitere interessante Informationen finden.
 Passwörter
Passwörter
Obwohl das Thema Internetsicherheit stark diskutiert wird, gelten „123456“ oder „password“ immern noch als die am häufigsten vergebenen Passwörter weltweit. Diese können jedoch sehr schnell gehackt werden, sodass private Daten in Gefahr sind. Denn nur ein gutes Passwort kann Konten und Profile richtig schützen. Doch wie generiere ich sichere Passwörter? Welche Regeln gibt es zu beachten?
-
Generell bestehen sehr gute Passwörter aus Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen.
-
Je mehr unterschiedliche Zeichen verwendet werden und je länger das Passwort ist, desto besser. Ein sehr gutes Passwort besteht aus mindestens 16 Zeichen.
-
Vermeide Namen von Haustieren oder Freund*innen sowie Geburtsdaten, Zahlenreihen (z. B. 12345) und Tastaturmuster (z. B. qwertz) da sie leicht zu erraten sind.
-
Die Kombination aus vier verschiedenen zufälligen Wörtern, welche mit Zahlen und Sonderzeichen miteinander abgetrennt werden, ist gut geeignet (z. B. Gummistiefel?3Zitronenbaum?Eltern3Papagei).
-
Aktiviere zusätzlich die Zwei-Faktor-Authentifizierung, d. h. das zusätzlich zu Benutzername und Passwort auch ein Zugangscode, welcher über SMS oder E-Mail versandt wird, notwendig ist.
-
Verwende für jedes Konto ein eigenes Passwort.
-
Notiere deine Passwörter, aber nicht auf dem Handy oder Computer (am besten auf einen Zettel!).
Dieser TED-Talk gibt weitere Einblicke in die Passwortsicherheit!
 Weiterführende Literatur
Weiterführende Literatur
https://www.saferinternet.at/themen/datenschutz
https://www.onlinesicherheit.gv.at/Services/Online-Ratgeber.html
Urheberrecht Click to collapse
Urheberrecht
Das Urheberrecht ist im Artikel 27 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (Resolution 217 A (III), UN Generalversammlung, 10.12.1948) verankert und lautet:
- Jeder hat das Recht, am kulturellen Leben der Gemeinschaft frei teilzunehmen, sich an den Künsten zu erfreuen und am wissenschaftlichen Fortschritt und dessen Errungenschaften teilzuhaben.
- Jeder hat das Recht auf Schutz der geistigen und materiellen Interessen, die ihm als Urheber von Werken der Wissenschaft, Literatur oder Kunst erwachsen.
Das Urheberrecht bezieht sich auf sämtliches geistiges Eigentum, wie zum Beispiel Literatur, Musik, Fotografie oder Filme. Der / Die Urheber*in hat dabei das Verwertungsrecht, d. h. diese Personen dürfen bestimmen, wer das geistige Eigentum zu welchem Umfang nutzen und bearbeiten darf.
Eine Urheberrechtsverletzung liegt also vor, wenn geschützte Werke (besonders aus dem Internet) ohne Zustimmung weiterverwendet werden. Gerade auch bei Fotos, auf denen andere Personen (erkenntlich) mitabgebildet sind bedarf es einer Zustimmung dieser Personen z. B. in Bezug auf das Hochladen in den Sozialen Medien, auch wenn sie das Foto selbst nicht gemacht haben.
Hier kann es schnell zu Problemen kommen, da das Urheberrecht in verschiedenen Ländern unterschiedlich gehandhabt wird. Eine Lösung hierfür bieten die so genannten Creative Commons Lizenzen – kurz CC-Lizenzen. Sie berechtigen Dritte dazu, Bilder, Texte oder Musik unter bestimmten Bedingungen weiterzuverwenden.
 Creative Commons - welche CC-Lizenzen gibt es?
Creative Commons - welche CC-Lizenzen gibt es?
|
Namensnennung
|
Die Werke dürfen weiterverwendet und bearbeitet werden, wenn der/die Autor*in genannt wird. |
|
Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen
|
Die Werke dürfen weiterverwendet und bearbeitet werden, wenn der/die Autor*in genannt wird und Anpassungen müssen unter den gleichen Bedingungen lizensiert werden. Sie wird auch als "Copyleft-Lizenz" bezeichnet. |
|
Namensnennung - keine Bearbeitung
|
Die Werke dürfen weiterverwendet werden, wenn der/die Autor*in genannt wird. Die Werke dürfen aber nicht bearbeitet werden. |
|
Namensnennung - nicht kommerziell
|
Die Werke dürfen weiterverwendet und bearbeitet werden, wenn der/die Autor*in genannt wird ausschließlich aber für nicht kommerzielle Zwecke genutzt werden. Die neuen Werke müssen nicht zu denselben Bedingungen lizensiert werden. |
|
Namensnennung - nicht kommerziell - Weitergabe unter den gleichen Bedingungen
|
Die Werke dürfen weiterverwendet und bearbeitet werden, wenn der/die Autor*in genannt wird ausschließlich aber für nicht kommerzielle Zwecke genutzt werden. Die neuen Werke müssen zu denselben Bedingungen lizensiert werden. |
|
Namensnennung - nicht kommerziell - keine Bearbeitung
|
Die Werke dürfen nur mit Nennung des/der Autor*in heruntergeladen und weiterverbreitet werden, aber nicht bearbeitet oder kommerziell genutzt werden. |
|
Public Domain
|
Bei Werken unter dieser Lizenz haben Autor*innen sämtliche Urheberrechte am Werk abgetreten, d. h. dass sie ohne Bedingungen weiterverbreitet und bearbeitet werden dürfen. |
Weitere Informationen findest du auf der offiziellen Webseite der CreativeCommons.
Open Educational Resources (OER) Click to collapse
Open Educational Resources (OERs)
Im Internet existieren teilweise viele Materialien, die gerade im Bildungskontext sich gut für den Unterricht oder das Studium eignen. Dabei kommt öfter die Frage auf, ob diese Materialien problemlos verwendet werden dürfen.
Open Educational Resources (OER) sind Lehr- und Lernmaterialien, die im Internet zur freien Verfügung zugänglich sind. Sie können ohne Erlaubnis verwendet werden – zählen also zu den
CC-lizensierten Materialien. Beispielsweise können dies sein:
-
Lehrbücher
-
Lehrveranstaltungsfolien
-
Podcasts
-
Online-Kurse (MOOCs)
-
Videos….
 Quellensammlung
Quellensammlung
Hier findest du eine Sammlung an möglichen OER Quellen:
|
Materialien, Lehrbücher und Online-Kurse |
|
|
Videos |
|
|
Bilder |
|
|
Audio |
|
|
OER Suchmaschine |
 Weiterführende Literatur
Weiterführende Literatur
https://www.saferinternet.at/themen/urheberrechte
iMOOX Selbstlernkurs: https://imoox.at/course/oermooc